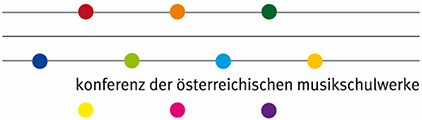KOMU-Lehrplan
Eine wesentliche Aufgabe der KOMU als Austausch- und Vernetzungsplattform der Musikschulorganisationen Österreichs und Südtirols besteht in der Bereitstellung von relevanten Informationen, die für Musikschullehrende, aber auch für andere an Musikschulen interessierte Personengruppen (Lehrende und Studierende von Musikuniversitäten/Konservatorien oder anderen Bildungseinrichtungen, Vertreter:innen von Ländern, Gemeinden, Verbänden und anderen Institutionen etc.) von Interesse sind. Diesem Selbstverständnis entsprechend haben Sie im Downloadbereich Zugriff auf vielfältige Dokumente aus dem Kontext der Musikschulen.
Alle Dokumente sind frei verwendbar und können weitergegeben, zitiert,… werden. Im Fall der Verwendung für Publikationen oder wissenschaftliche Arbeiten bitten wir um eine entsprechende Quellenangabe.
Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit den hier bereitgestellten Inhalten haben, wenden Sie sich bitte an die Koordinationsstelle der KOMU unter <Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, zum Ansehen müssen Sie in Ihrem Browser JavaScript aktivieren.>.
Alle Dokumente sind frei verwendbar und können weitergegeben, zitiert,… werden. Im Fall der Verwendung für Publikationen oder wissenschaftliche Arbeiten bitten wir um eine entsprechende Quellenangabe.
Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit den hier bereitgestellten Inhalten haben, wenden Sie sich bitte an die Koordinationsstelle der KOMU unter <Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, zum Ansehen müssen Sie in Ihrem Browser JavaScript aktivieren.>.
Lehrplan
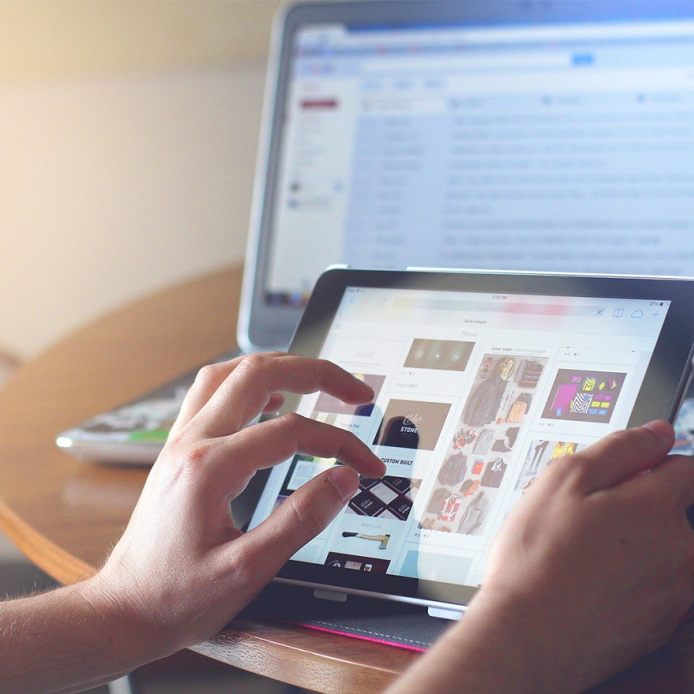
Downloads zum KOMU-Lehrplan
Über den KOMU-Lehrplan
Zur Entstehung dieses Lehrplans
Der „Gesamtösterreichische Rahmenlehrplan für Musikschulen“ aus dem Jahr 1994 war ein Meilenstein in der Entwicklung der Musikschulen Österreichs und Südtirols. Er war die erste „pädagogische Klammer“ über alle öffentlichen Musikschulen. Neben seiner pädagogischen Bedeutung war er auch „Motor“ für die Entwicklung der Musikschulstatute und die Erlangung des Öffentlichkeitsrechts für viele Musikschulen.
Im Jahr 2005 beschloss die KOMU, diesen Lehrplan grundlegend zu überarbeiten und an die aktuellen pädagogischen und strukturellen Gegebenheiten anzupassen, um den zahlreichen Entwicklungsschritten, die die Musikschulen in der Zwischenzeit getan hatten, gerecht zu werden. In einem zwei Jahre dauernden Prozess wurde der vorliegende KOMU-Lehrplan von über 2.500 Musikschullehrenden aus ganz Österreich und Südtirol gemeinsam entwickelt. Ausgehend von einem Treffen aller Fachgruppenleiter:innen im Herbst 2005, bei dem der Visionäre Wegweiser und der Allgemeine pädagogisch-didaktisch-psychologische Teil bearbeitet wurden, fanden in weiterer Folge Lehrplankonferenzen sowie Regionaltreffen statt, bei denen das Material des Fachspezifischen Teils gesammelt und bearbeitet wurde. Auch die Kunstuniversitäten (heute: Musikuniversitäten) und Konservatorien waren in diesen Prozess eingebunden.
Entstanden ist ein fachlich fundiertes und differenziertes, auch über die Grenzen Österreichs hinaus vielbeachtetes (inzwischen auch bereits mehrfach aktualisiertes) Lehrplanwerk mit vielen Querverbindungen und Vernetzungen, das seit seiner Einführung im Jahr 2007 als Richtschnur der Musikschularbeit in Österreich dient und aufgrund seiner wirklich als visionär zu bezeichnenden Struktur bis heute Gültigkeit hat.
Der Aufbau des KOMU-Lehrplans
Der Lehrplan besteht aus vier Modulen:
a) Der Visionäre Wegweiser: Dieser formuliert eine Vision von Musikschule, die nach innen und außen wirken will und definiert Grundpfeiler pädagogischer, künstlerischer und sozialer Natur. Er stellt sozusagen ein „Leuchtfeuer“ der Orientierung für Musikschularbeit im 21. Jahrhundert dar.
b) Der Allgemeine pädagogisch-didaktisch-psychologische Teil: Aufbauend auf den Visionen des ersten Teiles nimmt er grundlegende Bereiche der Musikschularbeit näher unter die Lupe und formuliert Erkenntnisse, die fächerübergreifende Gültigkeit haben. Er gibt damit allgemeine Handlungsanleitungen zur pädagogischen und künstlerischen Arbeit und beleuchtet den vielfältigen Wirkungskreis der Musikschulen, der sich in unterschiedlichste Bereiche erstreckt. So verdeutlicht er auch den umfassenden Beitrag, den die Musikschulen für unsere Gesellschaft leisten und zeigt die komplexe Verantwortung, der sich Musikschullehrende zu stellen haben. Gleichzeitig kann er für Lehrende eine ständige Fundgrube neuer Impulse und Schwerpunkte für die tägliche Arbeit sein.
c) Der Fachspezifische Teil: Dieser Teil ist sozusagen das „Einmaleins“ des Unterrichtens und hat sicher die konkretesten Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. In ihm werden die Grundsätze des Allgemeinen Teils auf das jeweilige Unterrichtsfach umgelegt. In 16 Punkten finden die Lehrenden ein detailliertes Anforderungsprofil sowie Empfehlungen und Hilfestellung für Unterricht, Elternarbeit, Vor-/Nachbereitung, Prüfungen,… vor. Trotz der fächerübergreifend (fast) einheitlichen Struktur bietet er individuelle Antworten auf die täglichen Fragen des Unterrichtens. Dabei wahrt er die so wichtige Balance zwischen bundesweitem Regelwerk und nötigem Spielraum für individuelle pädagogische Entscheidungen.
d) Die Literaturdatenbank: Sie ist als Praxiswerkzeug für Lehrende angelegt und bietet eine Auswahl pädagogisch geprüfter und vielfach praxiserprobter Unterrichtsliteratur.
Zur Literaturdatenbank
Die KOMU dankt allen Personen und Institutionen, die vom Entstehungsprozess an diesen Lehrplan mitgeprägt und ständig weiterentwickelt haben. Ein ganz besonderer Dank gebührt dabei allen Fachgruppenleiter:innen und speziell den Bundes-Fachgruppensprecher:innen aller Bundesländer und Südtirols für ihre unermüdliche Arbeit.